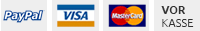Die Energieträger in Batterien
Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 15. März 2015.
In Batterien gehen verschiedene Elemente elektrochemische Reaktionen miteinander ein, um Strom zu liefern. Dabei geben diese Energieträger je nach Art unterschiedlich viele Elektronen ab oder nehmen sie auf. Chemische Energie lässt sich auf diese Weise in elektrische Energie umsetzen.
Hier stellen wir Ihnen einige Energieträger in Batterien vor.
Alkali
Alkali-Batterien gehören zu den am meisten verwendeten Arten von Batterien. Eine genauere Bezeichnung wäre aufgrund der beiden aktiven Elemente Zink-Manganoxid(Braunstein)-Zellen, in der Umgangssprache werden sie oft Alkali-Mangan-Batterien oder Alkaline genannt. Den Namen verdankt die Alkali-Batterie der alkalischen Kaliumhydroxid-Lösung, die als Elektrolyt oder Ionenleiter fungiert.
Alkali-Batterien sind in Form von zylindrischen Rundzellen (AA oder Mignon-Zellen) oder Knopfzellen erhältlich. Vereinzelt gibt es Kombinationen aus mehreren Zellen, beispielsweise den 9-Volt-Batterienblock aus sechs einzelnen Zellen. Alkali-Batterien sind Einweg-Batterien, sogenannte RAM (Rechargeable Alkaline Manganese)-Zellen können Sie aber begrenzt wiederaufladen. Sie lassen sich in allen Geräten einsetzen, bei hohem Stromverbrauch ist die Kapazität jedoch schnell erschöpft. Eine eventuell noch vorhandene Restkapazität nach dem Einsatz in Hochleistungsgeräten können Sie für Uhren oder Fernbedienungen nutzen.
Alkali-Batterien sind durch ein Gehäuse aus Metall sehr auslaufsicher. In seltenen Fällen tritt Kaliumhydroxid aus, welches mit dem Kohlendioxid der Luft zu Pottasche reagiert. Diese zeigt sich in weißen, kristallinen Ablagerungen.
Zink-Kohle
Eine Zink-Kohle-Batterie speichert Energie mit Hilfe einer Zinkelektrode, Mangandioxidpulver (Braunstein) sowie gepresster Kohle oder Graphit. Als Elektrolyt wird eine Lösung mit 20 Prozent Ammoniumchlorid verwendet.
Sie ist wie die Alkali-Batterie ein Primärelement, also nicht wiederaufladbar. Bis vor etwa 40 Jahren waren Zink-Kohle-Batterien weit verbreitet. Da aber der Elektrolyt häufig ausläuft und die Metallkontakte der Batterie und die Leiterbahnen zerfressen kann, verdrängten Alkali-Batterien die Zink-Kohle-Zellen schnell vom Markt. Zudem lassen sich Zink-Kohle-Batterien schlecht über längere Zeit lagern, da ihre Selbstentladung merklich höher ist. Die Anfangsspannung sinkt bei Verwendung stark ab, daher sollten Sie Zink-Kohle-Batterien nur noch in Geräten mit geringem Leistungsverbrauch einsetzen.
Lithium
Lithiumbatterien und Lithium-Ionen-Akkus, die auch oft Lithiumbatterie genannt werden, basieren auf Lithium als negativstem chemischen Element (etwa -3,05 Volt Standardpotential). Daraus ergeben sich eine hohe Kapazität und eine hohe Zellspannung. Da Lithium sehr stark mit Wasser reagiert, können in Lithiumbatterien nur nicht wässrige oder Festelektrolyte (meist Graphit) eingesetzt werden. Sie haben gegenüber Zink-Kohle-Batterien und Alkali-Batterien den Vorteil, dass sie äußerst lange in Betrieb genommen sowie gelagert werden können, da sie eine geringe Selbstentladung haben. Lithiumbatterien lassen sich außerdem unter extremen Temperaturen lagern und betreiben. Der am meisten verwendete Typ sind Lithium-Mangandioxid-Batterien, die Sie beispielsweise als Knopfzellen in Kameras oder Uhren einsetzen können.
Zink-Luft Air in Hörgeräten
Bei einer nicht wiederaufladbaren Zink-Luft-Batterie reagiert Zink mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft und erzeugt so elektrische Spannungen von 1,35 bis 1,4 Volt. Sie erweist sich als Knopfzelle in verschiedenen Größen als ideal für die Verwendung in Hörgeräten. Die Zink-Luft-Batterie kann in Betrieb genommen werden, indem Sie die Folie abziehen; anschließend tritt die Reaktion mit der Luft durch winzige Löcher in der Knopfzelle ein. Nachdem Sie die Lasche entfernt haben, müssen Sie die Batterie in wenigen Wochen verbrauchen. Versiegelt lassen sich Zink-Luft-Batterien lange lagern.
Silberoxid
Nicht wiederaufladbare Silberoxid-Zink-Zellen werden im Handel als Knopfzellen angeboten. Bei dieser Art von Batterien wird Zinkpulver während des Entladevorgangs oxidiert und Silberoxid zu Silber reduziert. Hier dient eine Kaliumhydroxidlösung als Elektrolyt. Eine Silberoxid-Zink-Batterie hat eine Nennspannung von etwa 1,55 Volt und ist vor allem in Kleingeräten wie Armbanduhren gut einsetzbar.
Nickel-Cadmium/Nickel-Metallhydrid
Die Elemente Nickel und Cadmium oder Nickel und ein Metallhydrid in Kombination werden zur Energiespeicherung in einer wiederaufladbaren Sekundärzelle oder Akkumulator, kurz Akku, verwendet.
Nickel-Cadmium(NiCd)-Akkus waren von der ersten industriellen Fertigung 1910 bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts die meistgenutzten Akkus, bis sie von Lithium-Batteriesystemen und Nickel-Metallhydrid(NiMH)-Akkus abgelöst wurden. Gründe dafür waren Bedenken wegen des giftigen Schwermetalls Cadmium und eine höhere Energiedichte von Lithium-Batterien. NiCd-Akkus stellen hohe Ströme bereit und werden größtenteils im Modellbau, in Elektroautos oder zur Notstromversorgung eingesetzt. Mit einem Elektrolyt aus Kaliumhydroxidlösung erreichen NiCd-Akkus eine Spannung von 1,2 Volt. NiCd-Akkus bieten die Vorteile, auch bei sehr tiefen Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius noch gute Kapazität zu haben und widerstandsfähig gegen Überladung und Tiefentladung zu sein.
NiMH-Akkus sind meist als Kleinbatterien, beispielsweise AA oder Mignon, erhältlich und liefern ebenfalls eine Spannung von 1,2 Volt. Sie enthalten keine giftigen Bestandteile und weisen eine etwa doppelt so hohe Energiedichte auf wie NiCd-Akkus. Dennoch haben sie im Vergleich mit NiCd-Akkus den Nachteil, dass man sie nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt einsetzen sollte. NiMH-Akkus sind geeignet für Geräte, die einen hohen Energieverbrauch haben. Für Uhren und Fernbedienungen mit langer Batterielebensdauer oder für die Sicherheit bedeutsame Apparate wie Feuermelder sind sie aufgrund der hohen Selbstentladung nicht zu empfehlen.